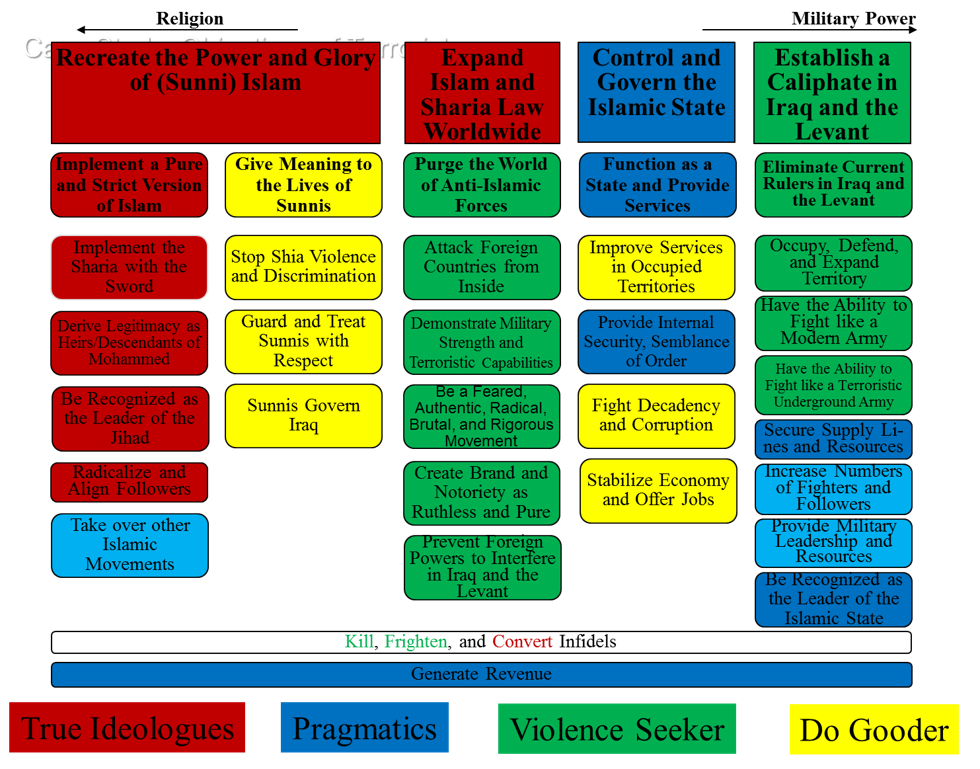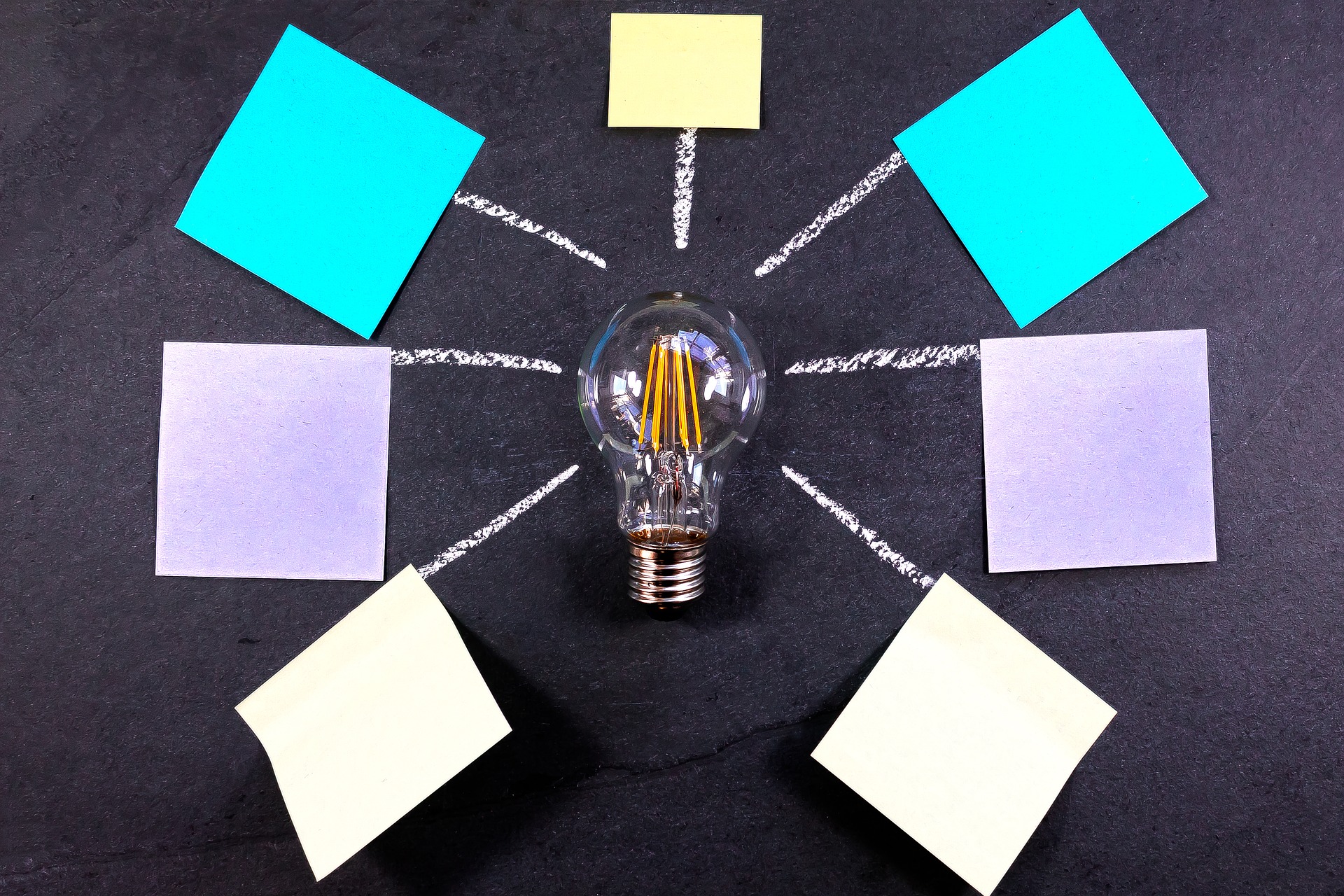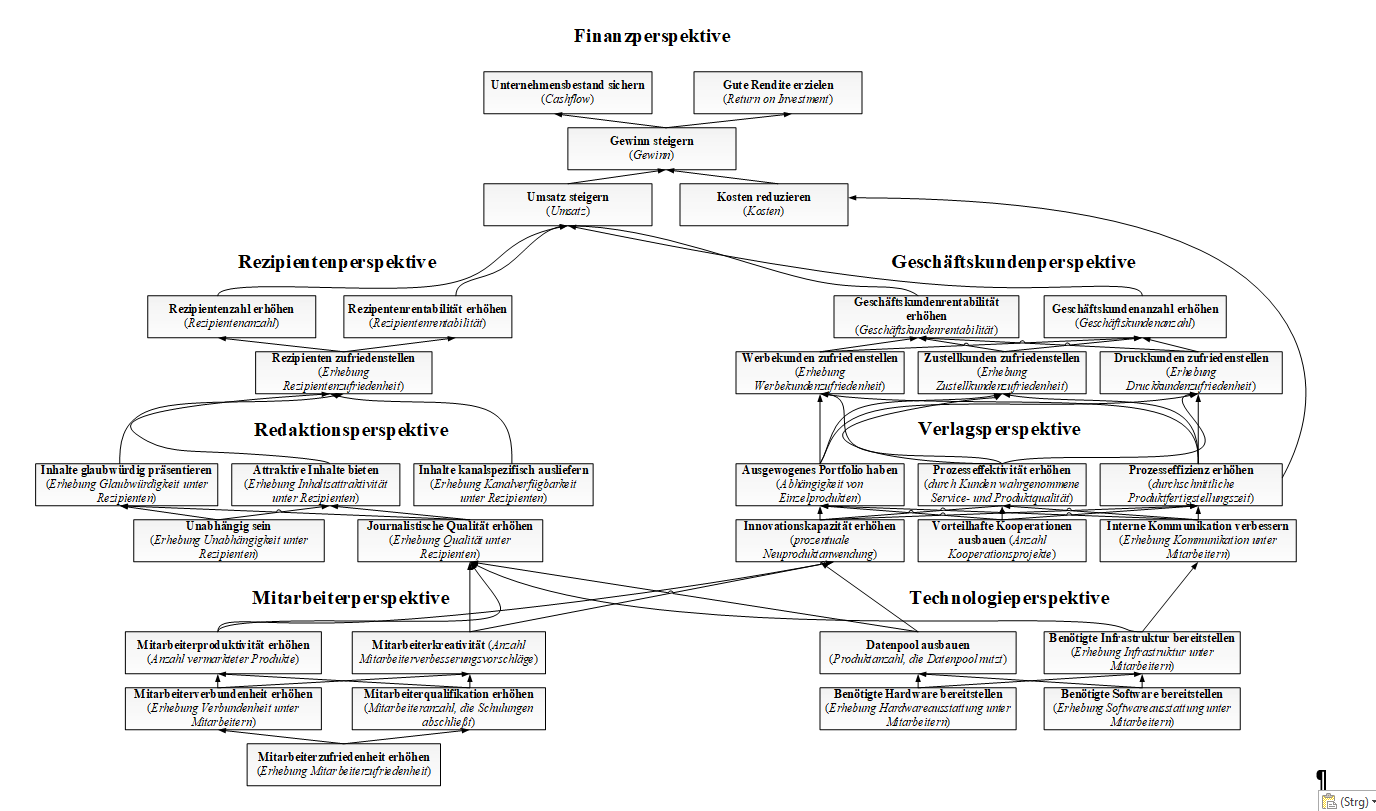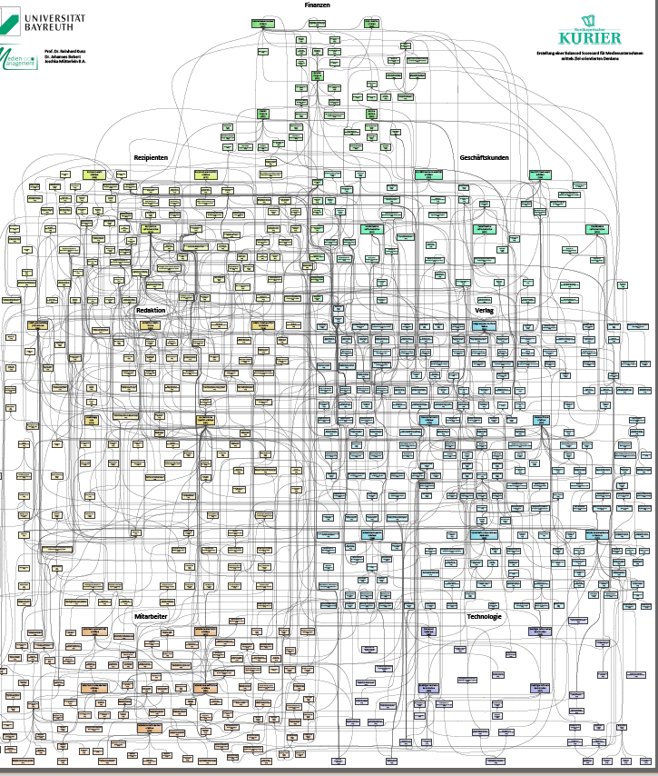Die Fähigkeit, Alternativen systematisch zu entwickeln, ist auch eine der sechs Dimensionen des Konstrukts „Proaktives Entscheiden“, das ich mit Kollege Kunz (Universität zu Köln) entwickelt habe. Im explorativen Stadium haben wir mit SPSS das Konstrukt theoretisch hergeleitet, konzeptualisiert und durch reliable und valide Items operationalisiert. Im konfirmatorischen Stadium haben wir unsere Skala quantitativ-empirisch getestet und validiert. Insgesamt konnten wir mit der Skala erstaunliche 48,3% der Varianz der Entscheidungszufriedenheit erklären.
In einem Folgeartikel zeigen wir, dass proaktives Entscheiden erlernbar ist, und erklären mithilfe eines Strukturgleichungsmodells über 35% der Lebenszufriedenheit. In einer weiteren Arbeit zeigen wir, dass durch unterschiedliche Vorlesungsformate proaktives Entscheiden trainierbar ist (Siebert et al. 2021). Wer lernt, proaktiv in Entscheidungssituationen zu agieren, ist somit zufriedener mit seinem Leben. Daraus lässt sich sehr eindrucksvoll ein zentraler Kompetenzerwerb für Studierende begründen.
Siebert, Johannes; Kunz, Reinhard. “Developing and Validating the Multidimensional Proactive Decision-Making Scale”. Sonderheft „Behavioral Operations Research“ der Zeitschrift European Journal of Operational Research, 249(3) 2016, 864-877
Siebert, Johannes; Kunz, Reinhard, Rolf, Philipp. “Effects of Proactive Decision Making on Life Satisfaction” (European Journal of Operational Research, in press. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.08.011)
Siebert, Johannes; Kunz, Reinhard, Rolf, Philipp. “Effects of Proactive Decision Making on Life Satisfaction” (European Journal of Operational Research, in press. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.08.011 )