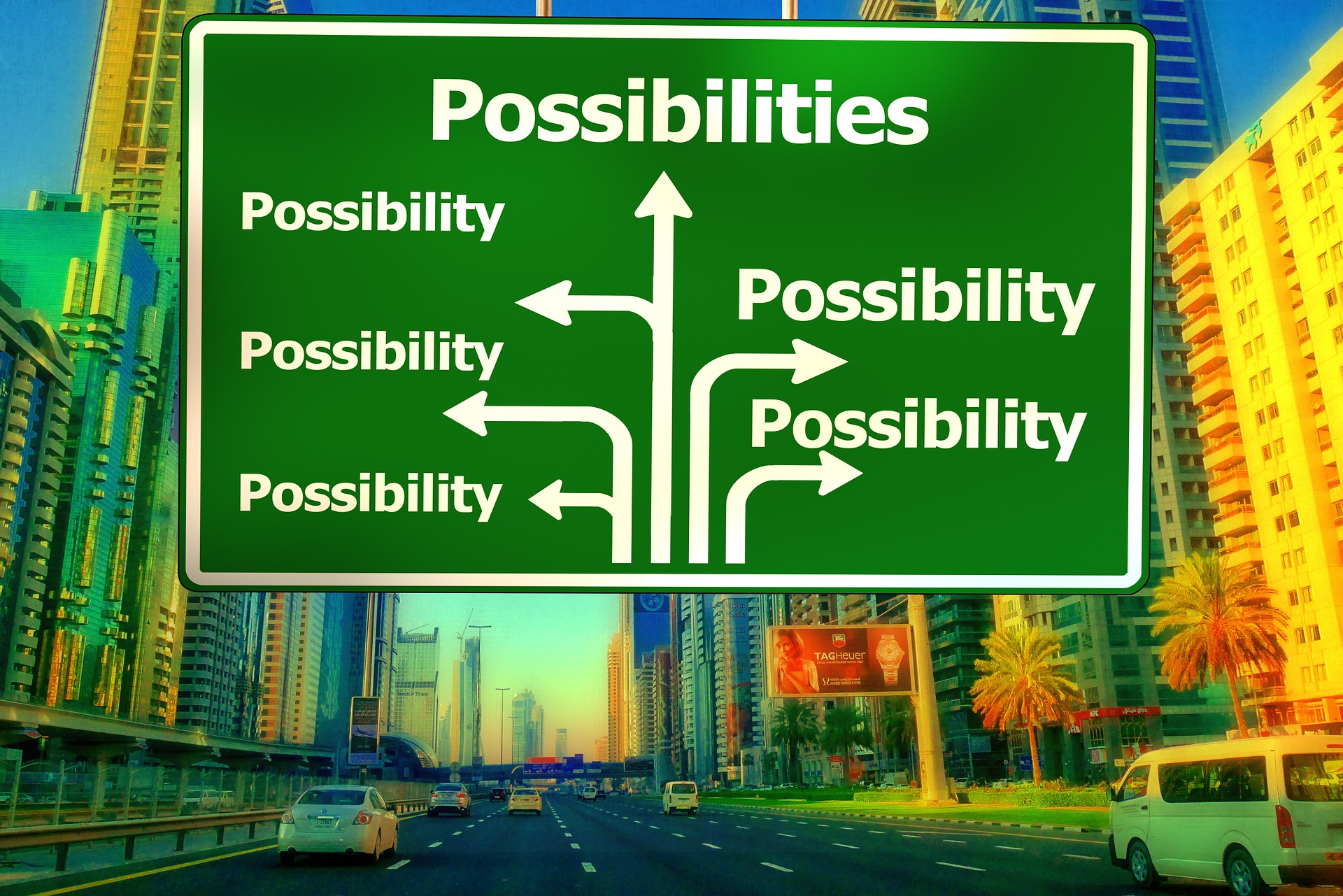Entscheiden ohne Tunnelblick – Wie sich die kreative Suche nach Alternativen lohnt
Menschen, die eine Entscheidung zu treffen haben, sind oftmals nicht in der Lage, alle für sie relevanten Alternativen zu erkennen. Ohne Unterstützung identifizieren sie in vielen Fällen nur weniger als die Hälfte der Handlungsmöglichkeiten, von denen sie – sobald sie explizit danach gefragt werden – glauben, dass sie in Betracht zu ziehen seien. Dies ergab ein Versuch mit rund 200 Bachelor- und Master-Studierenden in wirtschaftswissenschaftlichen oder wirtschaftsnahen Studiengängen. Im Vorfeld der Entscheidung für ein Praktikum identifizierten sie aus eigener Kraft nur 37 Prozent derjenigen Handlungsmöglichkeiten, die sie später als relevant bewerteten, wenn ihnen eine umfassende ‚Master-Liste‘ von Optionen vorgelegt wurde.
Creating More and Better Alternatives for Decisions Using Objectives
Unsere erste Studie zeigt, dass die Entscheidungsträger weniger als die Hälfte ihrer Alternativen identifizieren und dass die Qualität von Alternativen ist entscheidend für das Treffen guter Entscheidungen. Diese Forschungsarbeit, die auf fünf empirischen Studien zu wichtigen, persönlich relevanten Entscheidungen basiert, untersucht die Fähigkeit von Entscheidungsträgern, Alternativen für ihre wichtigen Entscheidungen zu entwickeln, und die Wirksamkeit verschiedener Stimuli zur Verbesserung dieser Fähigkeit. Unsere erste Studie zeigt, dass Entscheidungsträger bei Entscheidungen, bei denen die Gesamtheit der potenziell wünschenswerten Alternativen nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, weniger als die Hälfte ihrer Alternativen identifizieren und dass die durchschnittliche Qualität der übersehenen Alternativen dieselbe ist wie die der identifizierten. Vier weitere Studien geben Aufschluss darüber, wie Zielsetzungen eingesetzt werden können, um den Prozess der Alternativenbildung bei Entscheidungsträgern anzuregen, und bestätigen mit hoher Signifikanz, dass ein solcher Einsatz sowohl die Anzahl als auch die Qualität der gebildeten Alternativen erhöht. Anhand der Ergebnisse der Studien werden praktische Leitlinien…